|


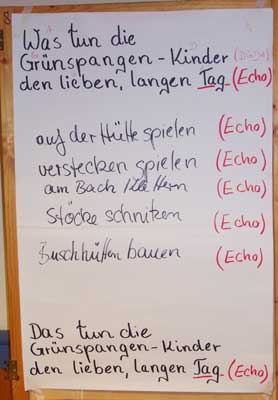
Der "Grünspangen-Song"
|
|
Erfahrungen:
Bürgerbeteiligung an der Grünplanung im neuen
Freiburger Stadtteil Vauban
Aufgabe, Situation und Beteiligte
Im neuen Stadtteil Vauban hat die Gemeinde Freiburg fünf
Grün- und Spielbereiche angelegt, die Grünspangen genannt
werden. Sie liegen zwischen jeweils zwei Häuserzeilen, sind 2.000
bis 2600 Quadratmeter groß und bis auf eine mit mehreren hohen
Bäumen bewachsen. Die Grünspangen sollten mit Beteiligung der
Anwohnerinnen und Anwohner ‚naturnah' gestaltet werden - im
Rahmen
des neuen Konzepts des Freiburger Amtes für "Stadtgrün und
Friedhöfe", wie das Gartenamt heute heißt (im folgenden kurz
“Stadtgrün” genannt). Seit 1996 werden neue städtische
Spielplätze auf diese Weise angelegt und ältere einer nach
dem
anderen umgestaltet.
Nachdem im Stadtteil Vauban bereits die ersten Wohnungen bezogen waren,
hatte Stadtgrün 1998 ein Landschaftsplanungsbüro mit der
Erstellung eines Vorentwurfs für alle fünf Grünspangen
beauftragt. Das Büro legte Vorschläge für die Verteilung
von Plätzen, Ruhe-, Grün- und Spielbereichen sowie
Wasserstellen vor, die dann in der ARGE Freiräume und Jugend
vorgestellt, besprochen und schließlich von der Verwaltung
beschlossen wurden.
Die Planung der einzelnen Grünspangen einschließlich des
Beteiligungsprozesses hat die Stadt, vertreten durch die
Kommunalentwicklung LEG, an verschiedene Landschaftsplanungs- bzw.
Gartenarchitekturbüros vergeben, die bereits Erfahrung sowohl in
der naturnahen Gestaltung als auch in der Zusammenarbeit mit
PädagogInnen zur Moderation der AnwohnerInnen-Beteiligung hatten.
Gestaltung der Kommunikation
- Ziele und Vorgaben
Durch die Beteiligung an der Ideenfindung sowie teilweise auch an der
Realisierung der Planung sollte die Identifikation der Anwohnerinnen
und
Anwohner mit ihrer Grünspange erhöht und mehr Achtsamkeit und
Rücksichtnahme erwirkt werden. Zudem sollte das Konfliktpotential
möglichst früh erkannt und eine halbwegs akzeptable
Verteilung
Lärm emittierender Bereiche erreicht werden.
Für die Beteiligung am Planungsprozess wurden fünf Treffen
vorgesehen, an denen neben dem Moderator auch der Architekt bzw.
Landschaftsplaner teilnahm. Zur jeweiligen Auftakt-Veranstaltung
erschien auch der für bürgerschaftliches Engagement
zuständige Stadtgrün-Mitarbeiter, um das Planungs- und
Pädagogenteam vorzustellen und die städtischen Vorgaben zu
erläutern. Mit der Planung der Grünspange 5, um die es im
folgenden geht, wurde das Team mit dem Landschaftsplaner Erich Lutz,
den
Moderatoren Antje Kirsch und Jürgen App vom Spielmobil Freiburg
sowie Reinhild Schepers für die Dokumentation beauftragt.
Folgende Vorgaben bestimmten den Rahmen der Planungsfreiheit:
1. Der alte Baumbestand und die Naturverjüngend sollte erhalten
werden, was weitgehend auch für den Strauchbestand galt.
2. Ein Platz mit Bänken sollte an der Fußgängerzone
Vaubanallee entstehen.
3. Wasseranschluss mit Pumpe sollte in der Nähe des Platzes und
eines Sandspielbereiches installiert werden.
4. Die Grünspange sollte durch Fußweg erschlossen werden,
den auch Pflegefahrzeuge benutzen können.
5. Der an der westlichen Längsseite verlaufende
Entwässerungsgraben sollte bestehen bleiben.
6. Die Geländegestaltung sollte Rücksicht auf den hohen
Grundwasserstand nehmen.
7. Einrichtungen, die Folgekosten verursachen, sollten möglichst
vermieden werden.
8. Die gesamte Installation sollte robust sein (Kriterium
Vandalismusschutz)
9. Die Grünspange sollte nach Fertigstellung eine öffentliche
Anlage mit entsprechenden Benutzerregeln werden.
Methoden und Ergebnisse
Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden per Aushang und mit
persönlichem Einladungsschreiben auf die Beteiligungstermine
aufmerksam gemacht. Beim ersten Treffen im Nachbarschaftszentrum des
Quartiers wurden die oben genannten Vorgaben auf einer Pinnwand
festgehalten und durch Overhead-Folien mit Plänen und Bildern vom
Grünspangengelände ergänzt. Dann wurden Fragebögen
verteilt, auf denen Kinder und Erwachsene nach Begehung des
Geländes darlegen konnten, was ihnen an der aktuellen
(provisorischen) Situation gefällt und was nicht und welche
Nutzungen sie sich wünschen. Die Fragebögen sollten bis zum
3.
Januar 2003 in einen Holzbriefkasten am Bauzaun eingeworfen werden. Wer
ein Bild dazu malen wollte, konnte es in die am Zaun angebrachten
Sichthüllen stecken. Von rund 60 ausgegebenen Bögen kamen 40
ausgefüllt zurück, dazu ein Dutzend Zeichnungen und Bilder.
Das zweite Treffen mit Erwachsenen am 10.01.03 wurde als eine stark
verkürzte Ideenwerkstatt im Bürgerzentrum organisiert, die
von
20.15 bis 23.00 Uhr dauerte. Mehr als diese drei Stunden hätten
das
vorgegebene Zeit- und Finanzbudget überschritten. Die Karten mit
den ängsten und Sorgen sowie den Wünschen und Ideen wurden
daher nach nur kurzem Andiskutieren sortiert und durch Bepunktung von
den Teilnehmenden gewichtet. So blieb noch Zeit für die
Ausformulierung der vier wichtigsten Ideen in Kleingruppen. Hierbei
entstanden folgende Ideenskizzen:
- Ruhe/Kommunikation: großer Ruhebereich mit Pergolen, in dem
Bänke mit Lehne, ein in den Boden eingelassenes Schachbrett und
ein
Brunnen als übergang zum Wasserbereich stehen.
- Wasserlandschaft: eine gestaltete, kleinräumige Landschaft mit
Wassersammelbecken, einem Wasserlauf und einem möglichst
geschwungenen Weg, u.U. mit Brücke.
- Spiel- und Bewegungslandschaft, gewünschte Elemente: ein
Klettergestell, verschieden hohe Reckstangen für Kinder und
Erwachsene, ein tiefer Sandbereich nicht zu weit weg von der Pumpe und
evt. noch eine Nestschaukel.
- Wildnis und gestaltete Natur: den Regenwassergraben mäanderartig
verändern, Gebüsch, Igelhöhlen, eine kleine Wiese, ein
Steinkreis und Findlinge, “diese Grünspange soll nicht so
übersichtlich wie die anderen werden”.
Die interessierten Kinder von 8 bis 12 Jahren konnten an einem
Samstagnachmittag ihre Ideen mit Ton, Holz und anderen Materialien in
kleine Modelle umsetzen. Mit den Jugendlichen wurde in Kooperation mit
dem Jugendzentrum JUKS in Gesprächsgruppen ein Fragebogen
ausgefüllt.
Der Planer hat aus den vielen, zum Teil schon detaillierten
Vorschlägen entsprechend den geäußerten
Grundbedürfnissen der drei beteiligten Anwohnergruppen, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, wesentliche Ideen aufgegriffen und
gemäß der räumlichen und finanziellen Bedingungen in
einen ersten Entwurfplan eingebaut. Diesen stellte er auf der
Versammlung am 24.01.03 vor. Er wurde besprochen und etwa vier Wochen
später in überarbeiteter Fassung erneut präsentiert.
Anwesend waren jeweils 25 bzw.30 Erwachsene und sieben Kinder.
Der Planungsvorschlag eines Pavillons und eines Sandspielbereichs
löste bei den direkten Anwohnern die Befürchtung aus, dass
dort eine Lärmquelle entstehen könnte. Andere Vorschläge
wie die ohrähnliche Form und Gestaltung des Platzes, die
Hängemattenlandschaft, das Heckenlabyrinth und viel Grün auf
hügelig modelliertem Gelände fanden allgemein Zuspruch.
Bei einem von einigen Anwohnern gewünschten Zusatztreffen mit
Ortsbesichtigung erläuterte ein Vertreter von Stadtgrün noch
einmal, dass ein Sandplatz bei der hohen Anzahl von Kleinkindern im
Stadtteil (fast 40 Prozent unter 12 Jahren) vorerst nicht, wie manche
wünschten, wegfallen könne
Bei einer Mitmachaktion in der Ausführungsphase haben vier
Schulklassen aus dem Stadtteil, Robinienstämme für das
Baumhaus geschält und Benjes-Hecken mit ästen und Zweigen
aufgefüllt, Kinder und Erwachsene haben am Robinienholzturm, der
“Wolkenburg", mitgebaut.
Erfahrungen und Empfehlungen
- Durch den Beteiligungsprozess wurde viel kreatives Potenzial
freigesetzt, auch wenn dem Gestaltungsspielraum aufgrund der
städtischen Vorgaben Grenzen gesetzt wurden.
- Die an die Grünspange angrenzenden Häuser wurden im Abstand
von mehreren Jahren gebaut. Bei Planungsbeginn wohnte ein großer
Teil der Beteiligten bereits mehr als drei Jahre dort. Trotz Bauzaun
wurde die Brachfläche von ihnen bei Planungsbeginn bereits
genutzt,
zum Beispiel für Komposter, für einen Sand-,
Bretterhüttenbau- und Grillplatz. So musste ein Umdenken erfolgen.
Bezüglich eines Grillplatzes gab es einige starke Befürworter
und Gegner. Daher wurde dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt. Zudem
hätte Stadtgrün wegen der engen Bebauung keine Erlaubnis
dafür gegeben.
- Alle Grünspangen sind zu schmal für einen gewünschten
Bolzplatz. Hier fand die Stadt aber im Sommer eine, wenn auch nur
vorübergehende Lösung: Sie legte einen Hartplatz an auf einem
noch nicht vermarktetem Grundstück am westlichen Ende, in
Bahndammnähe. Dieser ist den kleineren Kindern - und ihren Eltern
jedoch teilweise zu weit, zu laut und zu sonnig und es bleibt die
Frage:
Warum wurde nicht von vorneherein eine größere
Grünspange mit Ballspielplatz geplant?
- Für die Beteiligung an der Grünspangen-Planung war nicht
ausreichend Zeit vorhanden. Mehr Vorlaufzeit wäre günstig
gewesen, weil die Bewohnerschaft sehr unterschiedlich zusammengesetzt
ist: “Eingesessene" und neu Hinzugezogene, Senioren und in der Mehrheit
junge Familien. Sie wohnt in Miet- und Eigentumswohnungen sowie
Familienreihenhäusern. Die SeniorInnen sahen sich z.B, veranlasst,
ihre Bedürfnisse bei der Planung dieser letzten Grünspange
stärker einzubringen und neben den obligatorischen Spielbereichen
mehr Raum für Erholung und Beschaulichkeit zu fordern.
- Vorgaben für die Planung sollten so weit wie möglich
reduziert werden und gleich zu Anfang verdeutlicht, erklärt und
ggf. hinterfragt werden.
- Wenn eine vom Bevölkerungsdurchschnitt stark abweichende
Altersstruktur in einem neuen Stadtteil nicht verhindert werden kann
oder soll, so sollte die Gesamtplanung rechtzeitig auf entsprechende
“Wellen” etwa gleichaltriger NutzerInnen öffentlicher Räume
sowie das Problem der Minderheiten vorbereitet sein (40 Prozent Kinder
sind in fünf bis zehn Jahren entsprechend viele Jugendliche mit
ganz anderen Interessen).
- Eine Beteiligung, die über eine Ideensammlung hinausgeht, und
unterschiedliche Altersgruppen sowohl in getrennten als auch
gemeinsamen
Sitzungen mit einbezieht, braucht mehr als fünf zwei- bis
dreistündige Treffen. Aber auch eine reduzierte Partizipation ist
besser als keine, denn zu gibt den Anstoß zur Kommunikation mit
Nachbarn im weiteren Umfeld, wodurch sich vielleicht auch kleinere
Streitpunkte auf kurzem Wege regeln lassen.
-Anstelle von mehreren relativ kleinen Grün- und Spielbereichen
könnten sich durch eine z.B. doppelt so große
Grünspange
in zentraler Lage mehr Gestaltungsmöglichkeiten und
voraussichtlich
weniger Nutzungskonflikte ergeben, die aus dem engen Nebeneinander
erwachsen.
Reinhild Schepers |
|



